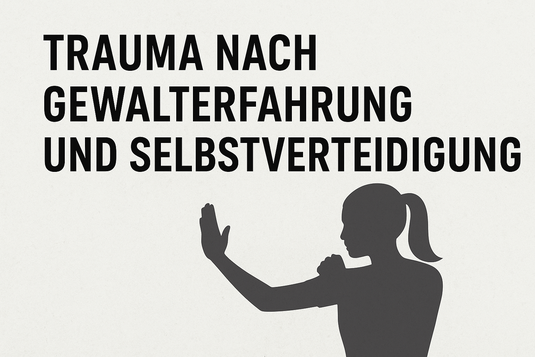
Gewalterfahrungen – körperlich, sexuell oder psychisch – können das Leben von Betroffenen tiefgreifend verändern. Neben akuten physischen und psychischen Verletzungen entstehen häufig langanhaltende Traumafolgen, die sich auf Körper, Geist und soziale Beziehungen auswirken. In diesem Kontext stellt sich die Frage: Wie verhält es sich mit Selbstverteidigung – sowohl der psychischen Selbstverteidigung als auch körperlich-praktischen Maßnahmen – bei Menschen, die Gewalt erlebt haben? Welche Chancen und Risiken ergeben sich, und wie kann ein traumasensibler Ansatz aussehen?
Was ist Trauma und welche Folgen können auftreten?
Ein Trauma entsteht meist, wenn eine Person einer Situation ausgesetzt ist, in der sie sich massiv hilflos fühlt, in Lebensgefahr ist oder die eigene körperliche Unversehrtheit bedroht ist – oder Zeuge solcher Ereignisse wird. Entscheidend sind nicht allein die objektiven Bedingungen, sondern auch die subjektive Wahrnehmung (Frauenberatung Österreich, 2023).
Typische Symptome nach Gewalterfahrungen sind wiederkehrende, intrusive Erinnerungen oder Flashbacks (LVR-Klinikverbund, 2022), Albträume und Schlafstörungen (Frauen gegen Gewalt e.V., 2023), Vermeidungsverhalten und sozialer Rückzug (LVR-Klinikverbund, 2022), erhöhte Schreckhaftigkeit und Nervosität (ebd.), sowie psychosomatische Beschwerden wie chronische Schmerzen oder Herzrasen (Infoportal Häusliche Gewalt, 2023). Auch Störungen im Selbstbild, Scham- und Schuldgefühle sind häufig (Complex Trauma e.V., 2021).
Je nach Art, Schwere, Dauer und Umfeld der Gewalterfahrung können auch komplexe Traumata entstehen, die sich in multiplen Symptomen äußern (Complex Trauma e.V., 2021).
Selbstverteidigung: Begriffe und Dimensionen
Um zu verstehen, wie Selbstverteidigung im Kontext von Trauma wirkt, muss sie differenziert betrachtet werden:
-
Vorbeugung und Deeskalation: Fähigkeiten, Situationen frühzeitig zu erkennen, zu vermeiden oder zu entschärfen.
-
Psychische Selbstverteidigung / Selbstbehauptung: Grenzen setzen, Wahrnehmung schärfen, Kommunikation trainieren, das Bewusstsein stärken, Rechte zu haben und
sich schützen zu dürfen.
-
Körperliche Selbstverteidigung: Techniken und Strategien, um Angriffe körperlich abzuwehren.
Wechselwirkungen zwischen Trauma und Selbstverteidigung
Risiken und Herausforderungen
-
Flashbacks und körperliche Trigger
Körperkontakt oder bestimmte Bewegungen können bei traumatisierten Personen intensive Flashbacks oder Angstreaktionen auslösen, insbesondere bei Erfahrungen sexueller oder körperlicher Gewalt (LVR-Klinikverbund, 2022).
-
Schockstarre / Freeze-Reaktion
In bedrohlichen Situationen reagieren viele Menschen nicht mit Kampf oder Flucht, sondern mit Erstarrung. Diese automatische Schutzreaktion kann durch frühere Traumata verstärkt werden und erschwert aktive Selbstverteidigung (LVR-Klinikverbund, 2022).
-
Scham und Selbstwertprobleme
Gewalterfahrungen untergraben oft das Selbstvertrauen und führen zu Schamgefühlen. Dies kann es schwer machen, sich selbst zu behaupten oder Verteidigungsstrategien zu erlernen (Complex Trauma e.V., 2021).
-
Überforderung im Training
Intensive Trainingssituationen können Stress und Retraumatisierungen auslösen, wenn sie ohne traumasensible Struktur erfolgen (Frauen gegen Gewalt e.V., 2023)
Potenziale und Chancen
-
Stärkung von Selbstwirksamkeit und Kontrolle
Durch Selbstverteidigung kann das Gefühl zurückgewonnen werden, Kontrolle über die eigene Sicherheit zu haben (Traumazentrum Kassel, 2024).
-
Verbesserung der Körperwahrnehmung
Körperliche Übungen fördern die Selbstwahrnehmung und stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten (Traumasensibles Lernen e.V., 2022).
-
Ressourcenaktivierung und Empowerment
Selbstbehauptungstrainings aktivieren persönliche Ressourcen und vermitteln Strategien, Grenzen zu setzen und Bedürfnisse klar zu kommunizieren (Traumazentrum Kassel, 2024).
-
Präventive Wirkung
Gewaltprävention und Deeskalation verringern das Risiko erneuter Gewalterfahrungen, indem Bewusstheit und Handlungsfähigkeit gestärkt werden (Traumasensibles Lernen e.V., 2022).
Traumasensible Selbstverteidigung
Damit Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für traumatisierte Menschen hilfreich und nicht schädigend sind, braucht es einen traumasensiblen Ansatz:
-
Sicherer Rahmen: Vertrauensvolle Atmosphäre, klare Kommunikation und freiwillige Teilnahme.
- Freiheit und Grenzen: Jede Person bestimmt selbst, wie weit sie gehen möchte.
-
Langsamer Aufbau: Erst psychoedukative Inhalte, dann praktische Übungen.
-
Triggerbewusstsein und Rückzugsoptionen: Möglichkeit, Übungen abzubrechen.
- Therapeutische Begleitung: Bei starker Traumabelastung Begleitung durch Fachpersonal (Frauen gegen Gewalt e.V., 2023).
Forschung und Praxis in Deutschland
-
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) nach Gewalt bei Jugendlichen: Eine Studie zeigt, dass 31 % der Jugendlichen nach körperlicher und 41 % nach sexueller
Gewalt eine PTBS entwickeln (Hogrefe Verlag, 2022).
-
Projekt ENHANCE (Universität Gießen/Ulm): Vergleich trauma-fokussierter Therapien bei Menschen mit Gewalt- und Missbrauchserfahrung (Universitätsklinikum Ulm,
2023).
-
Traumasensible Präventionsprojekte: Der Verein traumasensibles Lernen e.V. bietet Programme zur Gewaltprävention, die Körperarbeit, Psychoedukation und soziales
Lernen verbinden (Traumasensibles Lernen e.V., 2022).
- Selbstbehauptung in Traumazentren: Das Traumazentrum Kassel bietet Kurse, die auf Sicherheit, Grenzen und Empowerment fokussieren (Traumazentrum Kassel, 2024).
Empfehlungen
-
Selbstschutz als Teil der Behandlung verstehen.
-
Angebote traumasensibel gestalten.
-
Individuelle Vorbereitung und Anpassung.
-
Kombination aus Theorie und Praxis.
-
Soziale Unterstützung fördern.
- Nachsorge und Reflexion integrieren.
Selbstverteidigung kann ein wertvolles Instrument sein, um Menschen nach Gewalterfahrung in ihrer Selbstwirksamkeit und Autonomie zu stärken. Damit sie wirksam und sicher ist, muss sie traumasensibel gestaltet werden: mit Achtsamkeit, Flexibilität und professioneller Begleitung. Nur dann wird Selbstverteidigung nicht zur Konfrontation mit der Vergangenheit, sondern zu einem Schritt in Richtung Selbstbestimmung und Heilung.
Quellen:
Complex Trauma e.V. (2021). Trauma als Folge sexuellen Missbrauchs und kindlicher Gewalterfahrungen. Abgerufen von https://www.complex-trauma.info
Frauen gegen Gewalt e.V. (2023). Trauma und seine Folgen.
Abgerufen von https://www.frauen-gegen-gewalt.de
Frauenberatung Österreich (2023). Unterstützung bei Traumata nach
Gewalterfahrung. Abgerufen von https://www.frauenberatung.gv.at
Hogrefe Verlag (2022). Routineversorgung von Jugendlichen mit PTBS
nach sexualisierter oder physischer Gewalt in Deutschland. In: Psychotherapeut, 67(3),
214–225.
Infoportal Häusliche Gewalt (2023). Folgen von häuslicher
Gewalt. Abgerufen von https://infoportal-haeusliche-gewalt.de
LVR-Klinikverbund (2022). Gewalterfahrung und Traumafolgen.
Abgerufen von https://klinikverbund.lvr.de
Traumasensibles Lernen e.V. (2022). Traumasensible Gewaltprävention
und Pädagogik. Abgerufen von https://www.traumasensibleslernen.de
Traumazentrum Kassel (2024). Selbstbehauptungskurse für Betroffene
von Gewalt. Abgerufen von https://traumazentrum-kassel.de
Universitätsklinikum Ulm (2023). Projekt ENHANCE – Welche
Psychotherapie hilft Menschen mit Missbrauchs- und Gewalterfahrung? Abgerufen von https://www.uniklinik-ulm.de
